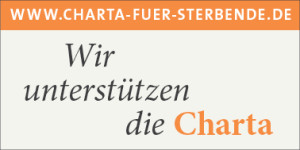INFORMATION
Sterbende begleiten schafft Zufriedenheit
Neue Pilotstudie für NRW untersucht Belastungs- und Schutzfaktoren
in Teams der Hospiz- und Palliativversorgung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Hospizarbeit und Palliativversorgung haben eine hohe Arbeitszufriedenheit und sie haben das Gefühl, diese Arbeit noch lange Zeit weiter ausführen zu können. Dennoch lassen sich Belastungsfaktoren identifizieren, die kontinuierlich in den Blick genommen werden sollten. Das zeigt eine neue landesweite Pilotstudie, die von ALPHA – Ansprechstellen im Land Nordrhein-Westfalen zur Palliativversorgung, Hospizarbeit und Angehörigenbegleitung – im Auftrag des NRW-Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und Soziales (MAGS NRW) durchgeführt wurde. Zehn Jahre nach der viel beachteten Vorgänger-Studie „Wie viel Tod verträgt das Team?“ (ALPHA Rheinland 2009, Autorenteam: Müller S., Pfister D., Müller M.) wurden die Entwicklungen der Versorgungslandschaft aufgenommen und der Untersuchungsfokus erweitert. Die jetzt vorgelegte Studie bietet ein detailreiches Bild dazu, warum Mitarbeitende in diesem Berufsfeld gern ihre Arbeit tun, aber auch, was sie als belastend empfinden.
In einer Befragung von Diensten und Einrichtungen wurden belastende und stärkende Faktoren untersucht, die die Arbeit in der Versorgung und Begleitung von schwerstkranken und sterbenden Menschen prägen. Befragt wurden Dienste der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV), Palliativstationen, Stationäre Hospize, Ambulante Hospizdienste (AHD), Ambulante Palliativpflegedienste sowie Palliativnetzwerke inklusive kooperierender Palliativpflegedienste und Qualifizierte Palliativ-Ärztinnen und Ärzte (QPA). Für den Einschluss wurde vorab das Erreichen einer Rücklaufquote von mindestens 75% pro Team festgelegt. Den umfangreichen Fragebogen beantworteten insgesamt 196 haupt- und ehrenamtlich tätige Personen aus 11 Diensten und Einrichtungen.
Als belastend empfinden die Befragten institutionelle sowie organisationale Faktoren (Zeit- und Personalmangel, hoher Dokumentationsaufwand), Kommunikationsschwierigkeiten, widersprüchliche Behandlungspläne bzw. Therapieziele sowie nicht gelungene Symptomkontrolle. Auch ein Mangel an Zeit wird als hinderlich für eine gelingende hospizliche und palliative Begleitung und Arbeitsweise wahrgenommen. Weitere Belastungsfaktoren liegen im persönlichen Bereich, wie z.B. ein überhöhter Anspruch an sich selbst, Ähnlichkeiten mit der begleiteten Person oder mit deren Situation, aber auch eine fehlende soziale Einbettung der Patientinnen und Patienten oder schwierige familiäre Beziehungen.
Zahlreiche stärkende Faktoren wurden von den Befragten benannt. So sind Familie, Privatleben, Freunde und Freundinnen treffen, Sport, Ablenkung und Humor wichtige Ressourcen für den beruflichen Umgang mit dem Tod. Insgesamt betrachtet haben sich für zwei Fünftel die Arbeitsbedingungen seit Aufnahme der Tätigkeit in der gegenwärtigen Verortung (sehr) verbessert. Hierzu zählen einerseits Fort- und Weiterbildungsangebote als auch eine hospizliche und palliative Informiertheit bzw. das Wissen darum. Einige Befragte sehen eine bessere Aufklärung und Kommunikation mit Patientinnen, Patienten und Zugehörigen als positive Entwicklung innerhalb der Versorgungslandschaft.
Die Antworten zeigen u.a. auch, dass die multiprofessionelle Arbeit im Feld der Hospiz- und Palliativversorgung gut funktioniert und die Arbeitsaufteilung und -abläufe den eigenen Wünschen entsprechen. Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlen sich im Team wertgeschätzt und haben das Gefühl, etwas bewirken zu können. Nahezu alle Befragten empfinden ihre Arbeit als sinnvoll und befriedigend. Ein Großteil ist zuversichtlich, dass ihr Team mehrere Jahre bestehen bleibt.
Ateş, G., Jaspers, B., Kern, M. (2020). Belastungs- und Schutzfaktoren in Teams der Hospiz- und Palliativversorgung in Nordrhein-Westfalen – eine Pilotstudie.
Sie können die komplette Studie hier kostenlos herunterladen.